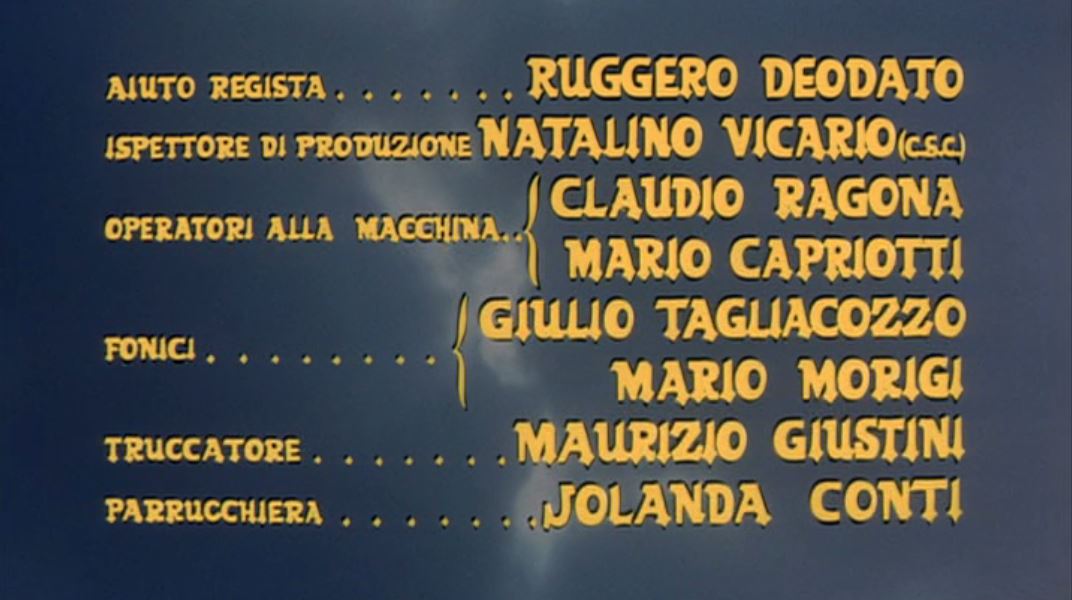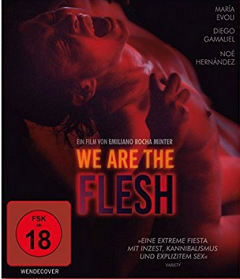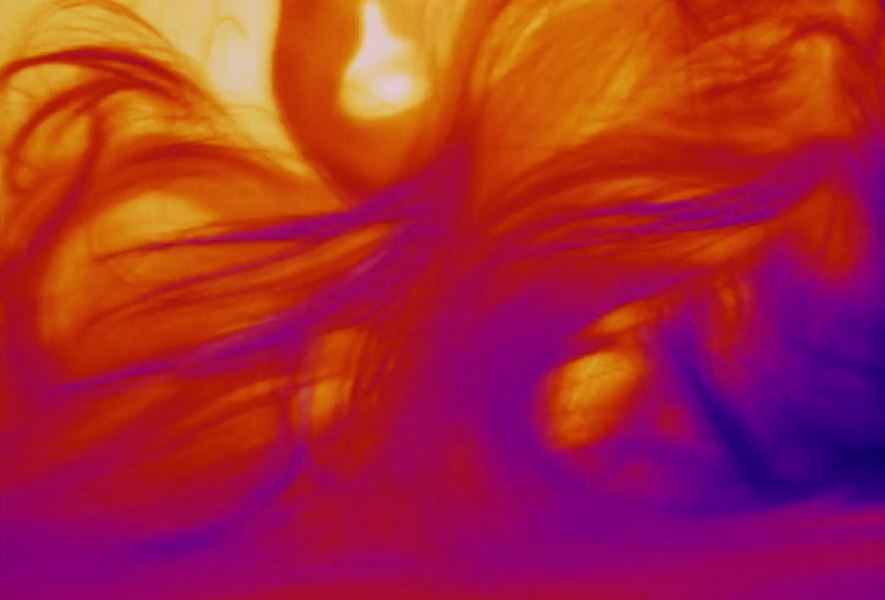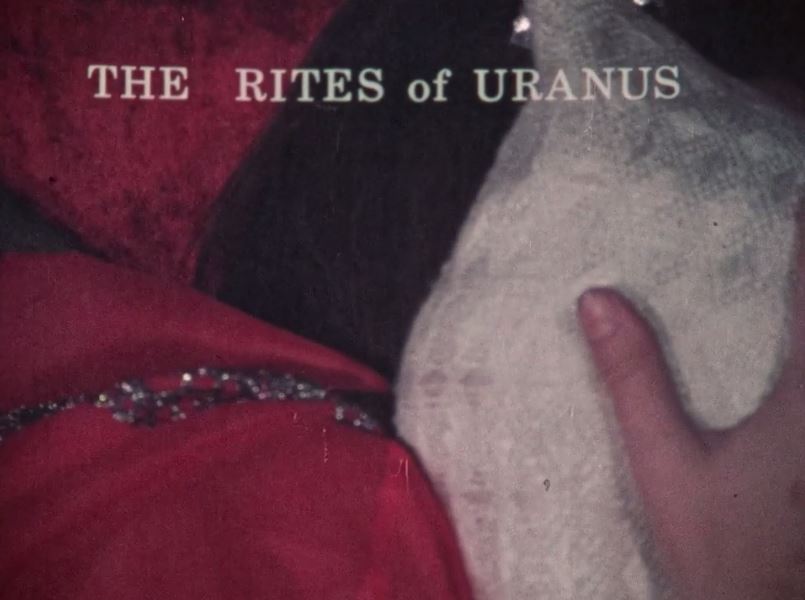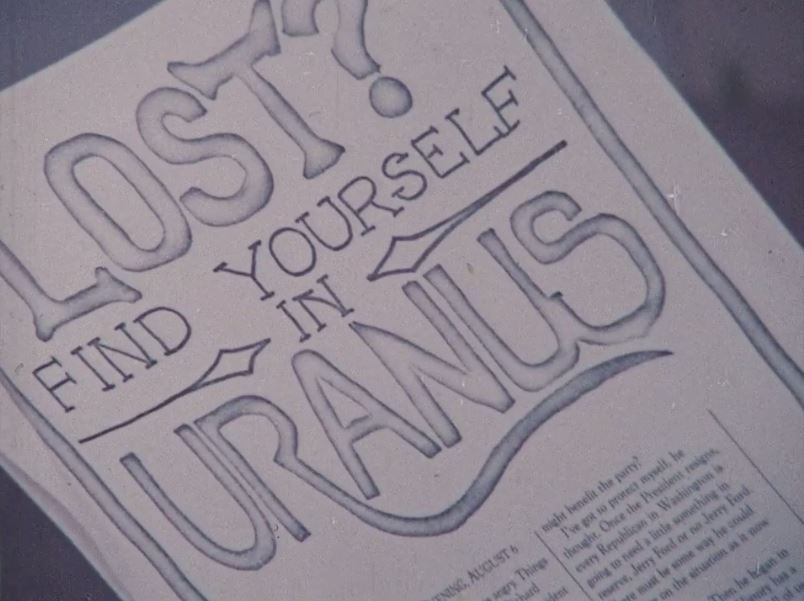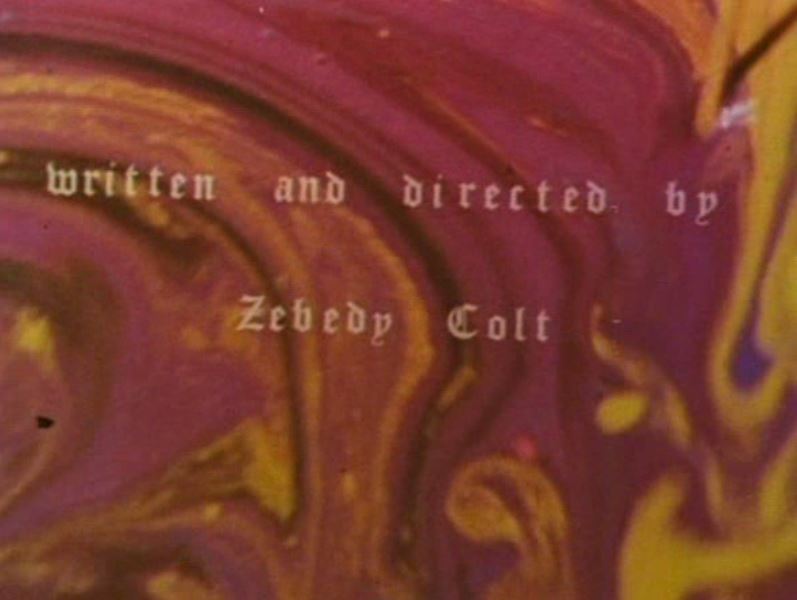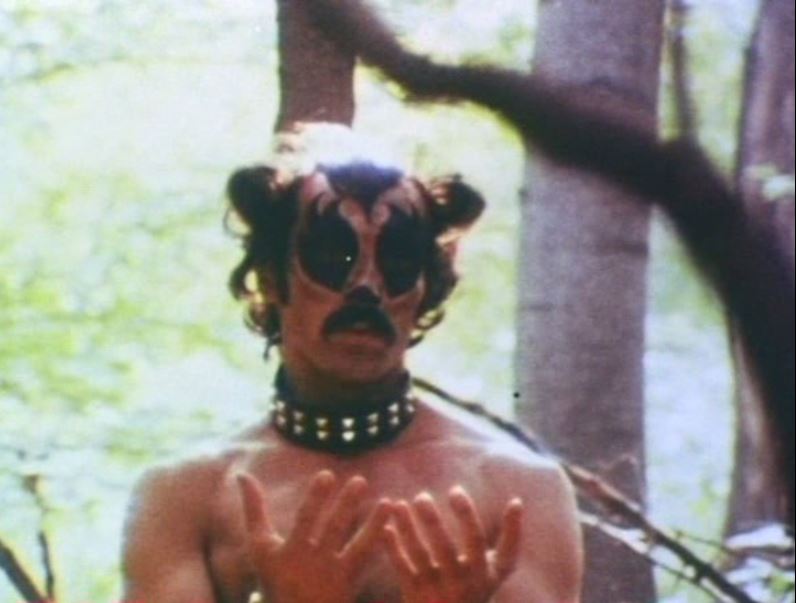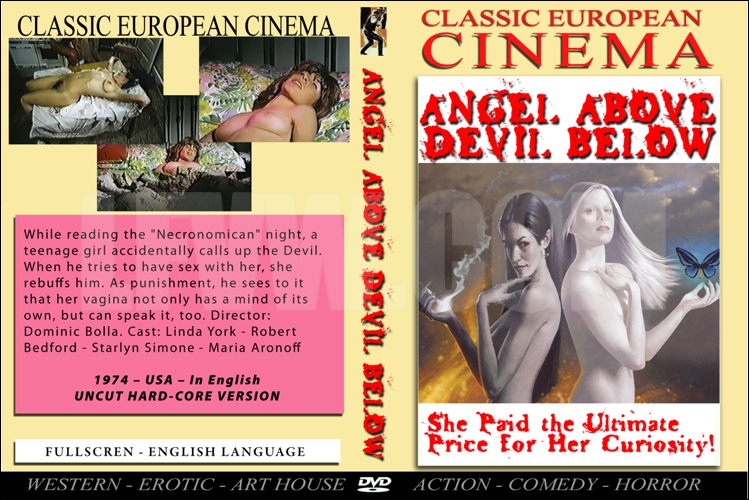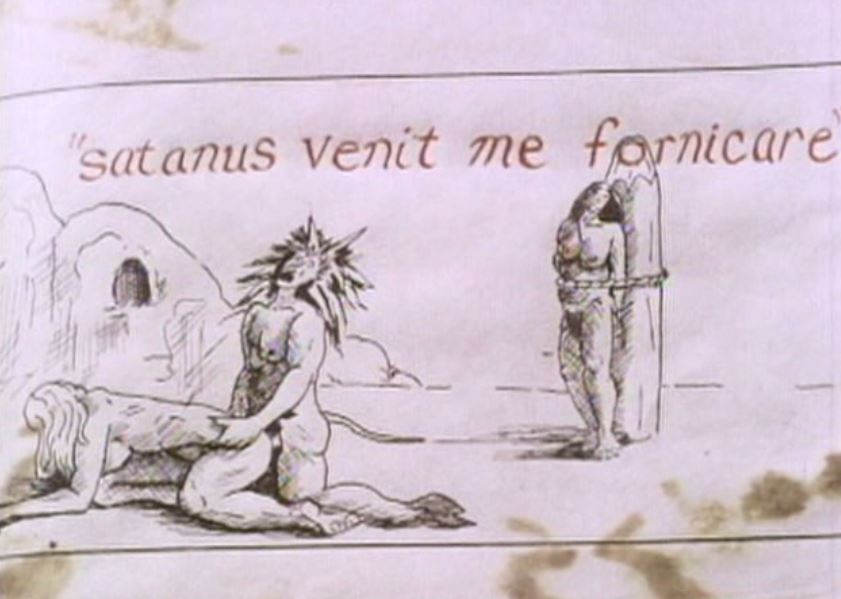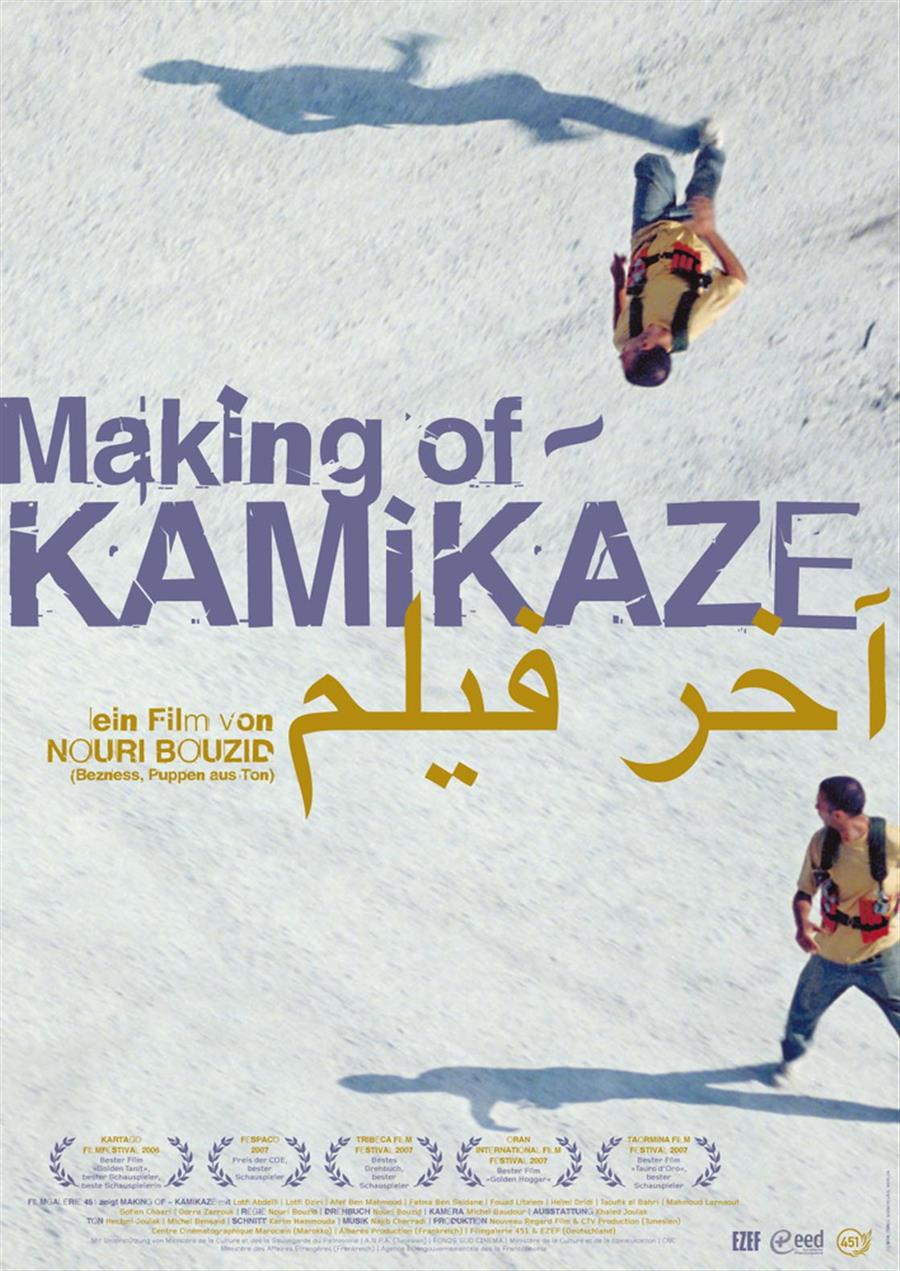Originaltitel: Koyaanisqatsi
Produktionsland: USA 1983
Regie: Godfrey Reggio
„ko.yaa.nis.qatsi (from the Hopi language), n. 1. crazy life, 2. life in turmoil, 3. life out of balance, 4. life disintegrating, 5. a state of life that calls for another way of living.”
Acht Jahre dauert die Produktion des US-amerikanischen Experimentalfilms KOYAANISQATSI. Zwischen den allerersten Dreharbeiten, die Regisseur Godfrey Regio und Kameramann Ron Fricke für ihr zu diesem Zeitpunkt noch diffus umrissenes Projekt anstellen – sie filmen 1975 die kolossale Sprengung des kolossal gescheiterten Sozialbaukomplexes Pruitt-Igoe in Missouri -, bis hin zum offiziellen Kinostart im Jahre 1983 – inzwischen hat man in Francis Ford Coppola einen Mentor gefunden, der über den ansonsten von Geldern des Instituts for Regional Education finanzierten Film seine prestigeträchtigen Hände hält -, sind verschiedene Konzept ent- und verworfen worden, und KOYAANISQATSI hat sich von einer reinen Portraitstudien New Yorker Alltagsmenschen hin zu einer dezidiert kritischen Gesamtschau der modernen Gesellschaft entwickelt, die vor allem aufgrund ihrer technischen Aspekte Anfang der 80er ihr Publikum regelrecht überwältigt haben muss. Gigantische Teleobjektive helfen Regio und Fricke, Objekte wie einen hinter einem Hochhaus verschwindenden Nachtmond oder eine Flugzeugschnauze derart nahe an uns heranzuholen, dass uns das Oft-Gesehene kaum noch vertraut vorkommt. Außerdem haben sie – was für ein Aufwand im analogen Zeitalter! – die Zauberkünste von Zeitraffer und Zeitlupe für sich entdeckt. Kaum eine Aufnahme in KOYAANISQATSI birgt nicht entweder dadurch, dass sie die in ihr dargestellten Bewegungen entweder stark verlangsamt oder stark beschleunigt, das Potential, dass wir selbst Ereignisse, mit denen wir in unserem Alltag andauernd konfrontiert sind, in einer bisher unbekannten Weise neu kennenlernen. Einen Kommentar gibt es in KOYAANISQATSI nicht, dafür ist der Film regelrecht erfüllt von der seriellen, meist elektronischen, manchmal auch mit Streichern, Bläsern, Chorgesängen verschnörkelten Musik Philip Glass‘, manchmal so frenetisch, manchmal so ungestüm, dass die Bilder fast unter ihr verschwinden.

In Wim Wenders‘ Dokumentation über seinen liebsten Filmemacher, den Japaner Yasojiru Ozu, TOKYO-GA (1985), kommt auch Werner Herzog zu Wort. Er beklagt sich darüber, dass in Tokyo, oder jeder beliebigen anderen Weltmetropole, inzwischen alles zugebaut sei, die Wolken, die Landschaft verstellt von Wolkenkratzern, Flugzeugen, Menschenmassen. Aber auch auf Bilder kann man diese Klage anwenden. Sobald das Kino – meist das abseitige – eine bestimmte Form gefunden hat, einen bestimmten Gedanken prägnant und pointiert visuell zu veranschaulichen, ist der Moment nicht weit, in dem diese Form Eingang findet in eine Werbeästhetik, die ihn instrumentalisiert, um mir mit ihm und durch ihn etwas zu verkaufen, das ich oft weder brauche noch überhaupt haben will. Ein solches verbrauchtes Bild wäre: Ein Wolkenkratzer, gefilmt von schräg unten, und wie die Wolkenwellen sich in seinen zahllosen quadratischen Glasscheiben spiegelnd im Zeitraffer vorbeiziehen. Oder: Der Sand in der Wüste, fein verwoben mit Windzügen, die die Dünen passieren und ihre anmutigen Silhouetten sowohl modellieren als auch sie entlangstreichen. Oder: Nächtlicher Verkehr, im Zeitraffer abgespielt, sodass die vielen Fahrzeuge zu bunten Lichtern werden, die wie an einer Kette entlangrasseln, hoch, runter, von links nach rechts, und umgekehrt, je nach Ampelführung. In KOYAANISQATSI sind solche Bilder noch die reinste Unschuld, unbeackert von Botschaften, die sie in den Dienst einer anderen Sache stellen würde als der erklärten Absicht Reggios und Frickes, uns, quasi von außen, aus der Perspektive eines Aliens oder eines Gottes, vorzuführen, in was für einem seltsamen, eigentlich unmenschlichem, unnatürlichem Trott wir Tag für Tag gefangen stecken – eine Unschuld, die man erst wiederfinden muss, nun, dreißig Jahre später, wo jedes zweite Musikvideo und jeder zweite Werbefilm auf gleiche Techniken, gleiche Bilder, gleiche ästhetischen Praktiken zurückgreift, um die Sinne zu fluten.
Die Canyons schlafen, menschenleer und majestätisch. Ein Fluss windet sich schlangengleich durch subtropische Waldteppiche. Mitten aus dem Ozean erheben sich zerklüftete Felsen, die nicht aussehen, als sei Leben dort möglich. Dazwischen wohnen wir per Archiv-Footage dem Start von Weltraumschiffen bei. Heftige Explosionen befördern die Raketen ins All, heftig wie die Geysire und Vulkanausbrüche, mit denen Reggio und Fricke diese Aufnahmen parallelisieren, heftig vor allem wie die Sprengungen nutzlos gewordener Wohnhäuser und Wolkenkratzer, die elegisch in sich zusammensacken, nachdem die Sprengkörper gezündet sind, und ertrinken in einem sich um sie herum aufbauschenden Kleid aus Rauch, das manchmal selbst die Kamera mitverschlingt. Solche Eruptionen stehen aber ziemlich vereinzelt im Fluss des Großstadtlebens, das KOYAANISQATSI am Beispiel New York vorführt: Fußgängervölker, Spielhallen-Pacmen, noch in den Kinderschuhen der Digitalisierung steckend, industriell verfertigte Autoteile, Schweinewürste, Jeansbeine, das alles verschmilzt zu einer Gesamtkomposition aus monotonen Sounds, monotonen Rhythmen, monotonen Bildern, die Reggios und Frickes Film fast bis zum Kollaps durchexerzieren. Nicht nur mir fällt es irgendwann schwer, weiter die Leinwand anzustarren – nein, nicht noch eine Runde, noch rasanter als die vorherige! -, auch der Film gleicht immer mehr einer Achterbahn, die ächzt und krächzt unter der sie entlangsausenden Wagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist bis alles in den Abgrund stürzt. Immer schneller werden die Schnitte, in immer heftigere Ekstasen steigert sich der Glass-Score, immer ermüdender werden die immer gleichen Abläufe, und immer konkreter schält sich der Kern dessen heraus, was nicht beschrieben, sondern nur gezeigt werden kann.

„Translation of the Hopi Prophecies sung in the film. ‘If we dig precious things from the land, we will invite disaster.’ – ‘Near the Day of Purification, there will be cobwebs spun back and forth in the sky.’ – ‘A container of ashes might one day be thrown from the sky, which could burn the land and boil the oceans.’"
Das Kuleschow-Experiment: Man nehme ein Lehrvideo für angehende Schlachter. Informell, nüchtern, ganz auf praktische Anwendung ausgerichtet wird uns gezeigt, wie das denn nun eigentlich funktioniert, das Zerlegen einer Kuh oder eines Schweins, ganz pragmatisch, ganz handfest. Das sieht zwar nicht angenehm aus, aber der sachliche Kommentar, die sachliche Kameraarbeit, das Fehlen eines noch so geringen exploitativen Voyeurismus halten das Filmchen davon ab, einem ärgere Magenschmerzen zu verursachen. Man nehme das gleiche Lehrvideo für angehende Schlachter, eliminiere die Tonspur und ersetze sie durch Ausschnitte einer beliebigen Wagner-Oper. Plötzlich scheinen sich die Bilder um hundertachtzig Grad gedreht zu haben. Was man eben noch mit dem Gedanken, so geht es eben zu in einem Schlachthaus, und das ist nötig, damit ich morgenfrüh meine Knoblauchwurst zum Frühstück essen kann, gewissermaßen wegkonsumieren und abnicken konnte, das erreicht und übersteigt jetzt auf einmal die Grenzen des Erträglichen. Es sind immer noch die gleichen Schweine, die da sterben, und die gleichen Hände, die da ausweiden, und die gleiche vermeintlich objektive Kamera, die dem Treiben zuschaut, als ginge sie das gar nichts an, und doch, allein durch die neue Tonspur, ist der Film nicht mehr auszuhalten, muss ausgemacht werden, sofort. Ohne die unglaublich suggestive, fiebrige Musik von Philip Glass – wie würde der Bilder-Rausch von KOYAANISQATSI dann auf mich wirken?
Dazu: Portraits von ganz normalen Menschen. Vier Casino-Damen posieren vor ihrem Arbeitsplatz im Neonlicht. Ein Obdachloser, scheinbar sturztrunken, wird von Polizeibeamten auf eine Bahre gehievt. Ein junger Mann beäugt grinsend das Treiben um sich herum auf der Straße. Ein Airforce-Pilot lehnt an seiner Maschine. Dazu: Noch mehr Archiv-Aufnahmen, von Panzern, hunderte, tausende, die in Formationen Ballett tanzen, und von Atombomben-Explosionen in der Wüste – wie der Pilz wächst, wird er wirklich zu einem organischen Lebewesen, zu einem Baum ganz ähnlich dem, den wir im Bildvordergrund sehen – und von einem gescheiterten Raketenstart, bei dem eine Atlas-Centaur in hunderte, tausende Stücke zerrissen wird, und die Kamera lange, unermüdlich dem Sinkflug ihres vorderen Abschnitts folgt, der sich um sich selbst dreht, graziös beinahe, schwache Funken und Flammen ausspuckt, einfach nicht den Erdboden erreichen will. Dazu hören wir von der Tonspur die von einem Bariton gesungenen Worte KOYAANISQATSI, die das Raketenfragment in einen Vorboten der bald anstehenden Apokalypse verwandeln.

Jeder Film hat seine Vorgänger hat – selbst die frühen Szenen der Lumière-Brüder sind aus dem Mutterleib der Photographie gekrochen -, und auch für KOOYANITSQATSI lassen sich welche finden, und zwar in den 20ern, in filmhistorisch ungemein wichtigen Werken wie Dziga Vertovs CHELOVEK S KINOAPPARATOM (1929), wo das Pulsieren russischer Großstädte zum assoziativen Querschnitt durch das Leben in der jungen Sowjetunion aneinandermontiert wird, oder, noch früher, Walter Ruttmanns BERLIN – DIE SINFONIE DER GROSSTADT (1927), wo die Deutsche Hauptstadt selbst zum lebenden Organismus stilisiert wird, in dessen Fluss die Menschen selbst zu bloßen bedeutungslosen Blutkörperchen werden. John Grierson, der Vater des didaktischen Dokumentarfilms, schreibt 1932 über letzteren Film kritisch: „Soweit der Film sich grundsätzlich mit Bewegungen und dem Aufbau von Einzelbildern zu Bewegungen befaßte, konnte ihn Ruttmann mit Recht eine Symphonie nennen. Es bedeutete einen Bruch mit der der Literatur entnommenen Geschichte und mit dem der Bühne entnommenen Schauspiel. In BERLIN wanderte die Kamera entsprechend ihren mehr natürlichen Kräften umher und schuf einen dramatischen Effekt aus der schnellen Folge von unzähligen Einzelbeobachtungen. […] Trotz allen Lärms um Arbeit und Fabriken und dem Saus und Braus der Großstadt sagt uns BERLIN nichts Wesentliches. […] Fünf Millionen Großstädter standen glänzend auf, stürzten sich in eindrucksvoller Weise in ihren ewig gleichen Tageslauf und gingen wieder zu Bett, aber kein andres göttliches oder menschliches Ergebnis kam zustande als das plötzliche Ausgießen von beschmutzendem Regenwasser über Leute und Pflastersteine.“ Was hätte Grierson wohl von KOYAANISQATSI gehalten, der sein Material, auf den ersten Blick, doch genauso rein auf sensualistische Überwältigung bedacht aneinanderreiht? Hätte Grierson die beiden Schlusstafeln, in denen Reggio und Fricke ihren Filmtitel erklären, schon als moralisch-ethischen Wert gelten lassen, oder hätte er denen auch den Vorwurf der Oberflächlichkeit gemacht?
Die Zeit jedenfalls hat es, mein Empfinden sagt mir das, gut mit KOYAANISQATSI gemeint. Klar, der Film operiert an einer pikanten Stelle. Ist das noch Kunst, ist das schon Kommerz? Ist die Botschaft zu plakativ, sind die Bilder teilweise derart überästhetisiert, dass sie schon mit einem Fuß im Kitsch stehen? Trotzdem, bewahrt hat sich dieser Film, den ich nur jedem, wie ich es erleben durfte, auf einer besonders großen Leinwand empfehlen kann, eine emotional packende Qualität, der zumindest ich mich schwer entziehen konnte - genauso wie einige seiner Bilder noch immer an mir haften wie Kletten: Das Flugzeug, das sich wie ein Insekt der Kamera entgegenschiebt. Die in sich zusammenknickenden Häuser wie von Narkosepfeilen getroffene Elefanten, die in Rauch aufgehen. Der vordere Teil der explodierten Rakete, der ein Tänzchen am Firmament aufführt, zur Einleitung des Weltuntergangs.