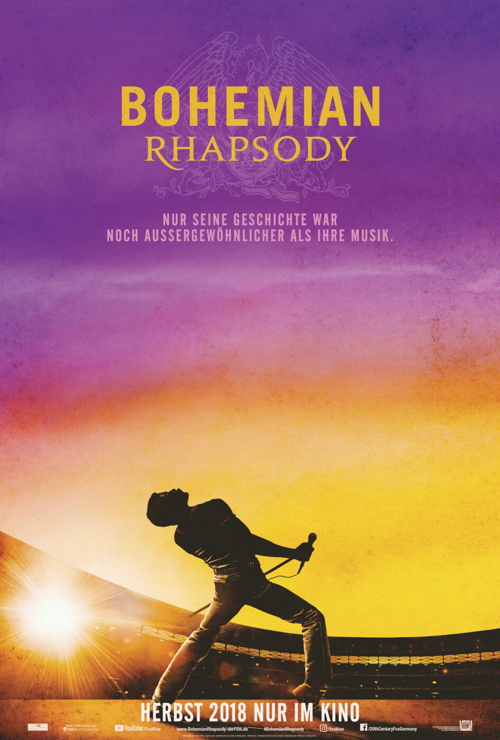Once Upon a Time in... Hollywood
Die Rache Tarantinos
„I'm the Devil. And I'm here to do the Devil's business.”
Es war einmal… ein US-amerikanischer Film-Nerd namens Quentin Tarantino, der eines Tages selbst ins Filmgeschäft drängte und vornehmlich altes, teilweise längst vergessenes Genrekino in Form von Zerrbildern wiederaufleben ließ und es mit einer derart koksgeschwängerten Pseudo-Coolness ausschmückte, dass sein junges Publikum einen eigenen Stil zu erkennen glaubte, den es hart abzufeiern galt, aber oftmals gar nicht erst auf die Idee kam, dass das Trivialkino vorausgegangener Generationen für ihn Pate gestanden haben könnte. Wer da wie der Verfasser dieser Zeilen schon frühzeitig abgewunken hatte, kann allerdings andererseits gar keine Aussagen hinsichtlich einer möglichen Entwicklung, eines Reifeprozesses oder etwaiger Stiländerungen treffen. Auf „The Hateful Eight“ folgte 2019 jedoch „Once Upon a Time in... Hollywood“, mit dem jener Film-Nerd aufgrund des einmal mehr bemühten Italo-Kino-Bezugs sogar einen solch alten Griesgram wie mich ins Kino locken konnte. Die US-amerikanisch-chinesisch-britische Koproduktion hat mit rund 160 Minuten deutliche Überlänge und lässt sich auf den ersten Blick nur schwer einordnen.
„Is everyone okay?“
Wir schreiben das Jahr 1969: „New Hollywood“ löst nach und nach das alte Studio- und Starsystem und auch dessen filmische Inhalte ab, Hippies treiben sich auf der Straße herum, Charles Manson war wieder auf freiem Fuß. Und Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio, „Critters III“) muss sich langsam, aber sicher eingestehen, dass sein Stern im Sinken begriffen ist. Die glorreichen Tage als Held der Western-Serie „Bounty Law“ liegen hinter ihm, seither bekleidet er Rollen als Antagonist in verschiedenen TV-Produktionen. Stets an seiner Seite ist Cliff Booth (Brad Pitt, „Todesparty II“), der nicht nur sein Stunt-Double, sondern auch sein Chauffeur und bester Freund ist. Als Rick das Angebot bekommt, Italo-Western in Europa zu drehen, nimmt er schweren Herzens an und wird dort tatsächlich zum Star diverser Produktionen. In Ricks unmittelbarer Nachbarschaft sind das junge Regie-Ass Roman Polanski (Rafael Zawierucha, „Warschau '44“) und dessen noch jüngere Frau, die Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie, „I, Tonya“), eingezogen. Als Rick aus Italien zurückkehrt, kommt es zu einer folgenschweren Begegnung mit den Mitgliedern der Manson Family…
„When you come to the end of the line, with a buddy who is more than a brother and a little less than a wife, getting blind drunk together is really the only way to say farewell.”
Was ist Tarantinos vor genau 50 Jahren ansetzender Film denn nun? Mag der Titel auch eine (irreführende) Anspielung auf Sergio Leones Großtaten sein, so ist er doch vor allem Indikator dafür, dass Tarantino uns hier ein Märchen erzählt. Eines, das zugleich ein
Buddy Movie ist und eine Persiflage aufs damalige Hollywood, vor allem aber ein großangelegtes Spiel mit der Erwartungshaltung des Publikums: Es geht nur am Rande um das Phänomen nach Europa gehender alternder US-Stars und um Italo-Western. Nein, es gibt keine Animositäten zwischen Rick und Cliff, wenngleich der eine für den anderen stets die Drecksarbeit verrichten muss. Nein, die
Manson Family steht nicht im Mittelpunkt der Handlung, Manson persönlich (Damon Herriman, „House of Wax“) schon gar nicht. Auch kommt es zu keinem Streit zwischen Rick und Polanski, also gewissermaßen zwischen dem alten und dem neuen Hollywood, beinahe alle erwartbaren Konflikte bleiben ausgespart. Dafür steht im Raum, dass Cliff seine Frau umgebracht hat. Wird er als Mörder enttarnt werden? Nichts dergleichen.
Ohne zu spoilern ist es mir unmöglich, diesen Film adäquat zu beschreiben, deshalb Obacht beim Weiterlesen: Die Prämisse dieses modernen, episodenhaften Märchen ist, dass alles gutgeht, im Prinzip also analog zu den klassischen Hollywood-Filmen mit ihren
Happy Ends. Damit ist sie Hinweis auf die Persiflage und Teil von ihr zugleich. Dass dies mit einer „alternativen Geschichtsschreibung“ in Bezug auf die stets unterschwellig lodernde Gefahr durch die
Manson Family einhergeht, ist somit klar und etwas, das Tarantino bereits mit „Inglorious Basterds“ erfolgreich in Bezug auf die Nazizeit durchexerziert hat. Ja, Rick hadert mit sich und dem Verlauf seiner Karriere. Diese verläuft jedoch keinesfalls im Sturzflug, im Gegenteil: Sie scheint sich mit Auslandserfolgen und TV-Einsätzen auf ein Niveau einzupendeln, mit dem sich eigentlich ganz leben lässt. Er ist eine einer Vielzahl überzeichnend karikierter Figuren, jedoch kein Unsympath, dem man den Absturz gönnen würde, über den das
New Hollywood süffisant triumphieren würde. Er ist auch nicht das andere Extrem, kein tragischer Held. Rick ist einfach ein Schauspieler, an dessen Exempel Tarantino die natürliche Diskrepanz zwischen den Rollen im Job und den Privatpersonen aufzeigt. Privat ist Rick ein etwas verunsicherter Typ, der leicht zu stottern neigt und mit der Zeit ein Alkoholproblem entwickelt hat. Als er erkennt, dass ihn dieses bei der Ausübung seines Berufs behindert, schwört er in einer grotesken Monologszene dem Alkohol ab und entwickelt neuen Ehrgeiz – und in diesem Märchen gelingt ihm das auch. Ein kleines Mädchen (Julia Butters, „Das Glück des Augenblicks“) erklärt ihm
Method Acting und scheint dabei selbst in einer Rolle zu stecken, nämlich der einer erwachsenen Frau – so abgeklärt und lebensklug wirkt es: eine Persiflage auf unrealistisch reife Kinderfiguren in Filmproduktionen. Tatsächlich wächst Rick während der Dreharbeiten mit dem Mädchen über sich hinaus, bis er sie spontan brutal von seinem Schoß auf den harten Holzfußboden stößt, weil er so sehr in seiner Rolle ist. Und natürlich zieht auch dies keine negativen Folgen nach sich, denn das Mädchen hatte vorgesorgt und Protektoren unter der Kleidung getragen…
Booth wiederum verkörpert den Archetypus des Hollywood-Draufgängers, dem nichts und niemand etwas anhaben kann: Schlägereien entscheidet er grundsätzlich für sich, ohne wirklich Schaden zu nehmen, und vermutlich würde er auch jedem Kugelhagel durch geschickte Ausweichmanöver standhalten, während bei ihm jeder Schuss ein Treffer wäre. Ein wahrer Teufelskerl, der sogar damit durchkommt, seine Frau umgebracht zu haben. Seine Unverwundbarkeit hat dieser Mann zum Beruf gemacht, er ist Stuntman. Und er ist die Definition von Coolness. In einer köstlichen Szene, die Bruce Lees selbstgefälliges Esoterik-Gefasel kräftig aufs Korn nimmt, nimmt er es sogar mit eben jenem Kampfsportstar auf. Jemand wie Booth ist nicht real, er ist eine typische Hollywood-Erfindung, die bis zu den bekannten
One-Man-Army-Actionhelden weiterentwickelt wurde.
Zumindest zeitweise eine größere Rolle spielt auch Sharon Tate, die in ihrer unbeschwert-naiven Art kein Wässerchen trüben kann, der man es nicht ankreidet, wenn sie keinen Eintritt im Kino zahlen will, weil sie in „Rollkommando“ selbst mitspielt, und die sich auf herzerwärmende, ansteckende Weise darüber freut, wie gut ihre schauspielerische Leistung beim Publikum ankommt, während sie entspannt ihre hübschen Beine hochlegt und Fetischist Tarantino damit eine weitere Möglichkeit bietet, Damenfüße prominent einzufangen. Welch ein Sonnenschein! Und welch eine Episode, die in kaum einem Zusammenhang mit dem Rest des Films steht, aber die Erwartungshaltung provoziert, dass Sharon Tate – wir wissen ja um die Morde der
Manson Family – noch übel mitgespielt werden wird.
Diese Erwartung wird auch unweigerlich geweckt, wenn Cliff die minderjährige Hippie-Anhalterin Pussycat (Margaret Qualley, „The Leftovers“), ebenfalls barfüßig, zur
Spahn Ranch mitnimmt, wo die
Manson Family residiert. Den ihm angebotenen
Blowjob lehnt Cliff dankend ab – wir befinden uns schließlich in einem Hollywood-Märchen. Als Cliff auf der Ranch nach dem Rechten sehen will, weil es ihm suspekt ist, dass sein alter Bekannter George Spahn (Bruce Dern, „Lautlos im Weltraum“) sein Anwesen einer Gruppe verlauster Hippies überlässt, inszeniert Tarantino diese Szene im Terrorkino-Stil à la „The Texas Chainsaw Massacre“, um der
Suspense-Haltung des Publikums – man ahnt es – erneut ein Schnippchen zu schlagen. Weder scheint Spahn hier gegen seinen Willen festgehalten und erpresst zu werden noch wird Cliff von langhaarigen Mörderbestien zerfleischt, im Gegenteil: Er ist es, der hier austeilen darf und damit dem Bedrohungsszenario triumphierend trotzt.
Zum Märchencharakter passt auch der Erzähler aus dem
Off, der irgendwann verstummt und nach einem sechsmonatigen Zeitsprung, als man ihn längst vergessen hat, wieder einsetzt. Was sich nun abspielt, mündet in der Umschreibung der wahren Geschichte, indem Tarantino seinen ersten und einzigen Gewaltexzess dieses Films nicht nur nutzt, um derartige Gewaltexzesse schwarzhumorig zu persiflieren, sondern vor allem, um Mansons Mörderbande das zu geben, was sie verdient gehabt hätte und sie gleichzeitig als das zu zeigen, was sie war: Eine Anhäufung ganz armer Würstchen. „Once Upon a Time in... Hollywood“ verweigert sich jeglicher Glorifizierung, Romantisierung oder Mythisierung der Mörder(innen) und lässt das alte Hollywood über sie triumphieren und so gleichzeitig das
New Hollywood vor ihnen schützen. Mit dieser Geschichtsklitterung rückt Tarantino die Verhältnisse angesichts des fragwürdigen Ruhms, den Manson zeitlebens genoss, ein gutes Stück weit zurecht, so paradox das klingt. Tarantinos Rache für die Zerstörung einer Illusion.
Doch damit nicht genug: Ein klein wenig subtiler zermantscht Tarantino hier stellvertretend auch diejenigen seiner Kritiker(innen), die gebetsmühlenartig wiederholen, die Darstellung von Gewalt in Spielfilmen würde reale Gewalt nach sich ziehen, weshalb man wiederum am besten gewaltsam, z.B. in Form von Zensur, gehen sie vorgehen müsse. Eine der verhinderten Mörderinnen argumentierte nämlich ganz ähnlich: Sie wolle diejenigen töten, die ihr auf den Bildschirmen das Töten erst beigebracht hätten. Schade nur, dass die Mehrschichtigkeit dieses Finales im Gejohle des Kinopublikums unterzugehen droht, das sich freut, endlich das zu bekommen, wofür es Tarantino seines Erachtens bezahlt hat: Übertriebene, durchchoreographierte und mit lässiger Kaltschnäuzigkeit dargereichte Gewaltspitzen.
Dabei sind so viele andere Momente so viel schöner: Wenn Steve McQueen auf einer Party über Beziehungen sinniert und später DiCaprio in einen Ausschnitt aus „Gesprengte Ketten“ anstelle McQueens hineinretuschiert wird. Oder wenn die Plakate für Ricks fiktive Italo-Western an tatsächliche Genre-Klassiker erinnern (wenngleich sich diesbzgl. ein Fehler eingeschlichen hat: Einen Anti-Indianer-Italo-Western gab es meines Wissens nie, die waren den US-Rassisten vorbehalten), wenn es zahlreiche Gastauftritte namhafter Mimen zu entdecken und Insider-Gags, aber auch einen ganzen Schwung an Selbstreferenzen, zu entschlüsseln gibt. Wunderbar auch die Szene, in der Rick und Cliff sich ein Bierchen aufreißen und zusammen die neue Folge der TV-Serie „FBI“ kommentierend ansehen, in der Rick den Bösewicht mimt. Szenen wie diese kostet Tarantino ohne Rücksicht auf eine etwaige Dramaturgie minutenlang und tiefenentspannt aus. Manch eine(r) wird es auch genießen, wie Tarantino den Körperkult und Voyeurismus des Kinos verballhornend attraktive Damen grundsätzlich von unten nach oben abfilmt, als er würde er sie abtasten, oder wie Brad Pitt vollkommen selbstzweckhaft seinen durchtrainierten Oberkörper zur Schau stellt. Überhaupt, die männlichen Hauptrollen: Welch eine Besetzung! DiCaprio beweist vom ersten Moment an, dass er wahrhaftig einer der besten und wandlungsfähigsten zeitgenössischen US-Schauspieler ist, seinen Rick Dalton kauft man ihm sofort ab. Bei Cliff Booth habe ich etwas länger gebraucht, um Brad Pitt dahinter zu vergessen, seine durchstilisierte Rolle hat dafür einen umso nachhaltigeren Eindruck hinterlassen. Der Soundtrack mit seiner vom Regisseur handverlesenen „My personal best of ‘60s“-Auswahl wird als LP ein Verkaufsschlager und einen (gelungenen) finalen Gag im Abspann lässt Tarantino sich natürlich auch nicht nehmen.
Nach diesem weiß man: Nein, die eingeblendeten Zeitangaben bedeuteten nicht, dass Ricks oder Sharons Zeit abläuft, sie waren kein Countdown bzw. -up zum Untergang von Protagonisten. Tarantino erzählte das schöne Märchen eines Hollywoods, wie er es sich gewünscht hätte, eines Hollywoods, in dem das alte und das neue Hollywood sich einander freundlich zugewandt koexistieren und in dem der Schock der Manson-Morde und dessen Folgen einfach ausblieben. Und weil man mit so etwas nicht durchkommt, veralbert er es zudem auf eine unnachahmliche, höchst liebevolle, herzliche Weise. Noch einmal zurück zur Erwartungshaltung: Ich hatte gehofft, einen Film über US-Schauspieler in Italo-Western, wie weiland Eastwood, Reynolds & Co., zu sehen. Ich bekam etwas ganz anderes, das ich zunächst nicht richtig einordnen konnte. Eine Ode ans Hollywood der ausklingenden 1960er, die nicht einmal einem Sensibelchen wie mir Gänsehaut bereitet, stattdessen den Pöbel um mich herum laut polternd zum Schenkelklopfen gebracht hat? Doch kurz darauf fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren und ich musste lachen, wie ich es seither immer muss, denke ich an diesen Film zurück.