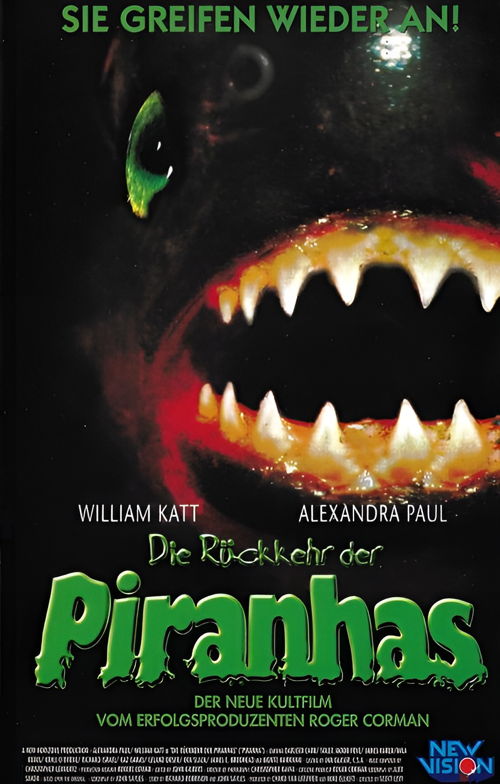Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 00:14

Kalt wie Eis
Neo-Noir in Neon
„Sieh doch ein, wir sind hier nicht im Dschungel – es sieht nur manchmal so aus…“
Anfang der 1980er finanzierten die Unterhaltungs- und Schmuddelfilm-Produzenten Karl Spiehs und Wolf C. Hartwig dem jungen Schweizer Regisseur Carl Schenkel („Knight Moves – Ein mörderisches Spiel“) dessen Abschlussarbeit für die Filmhochschule, nachdem er 1979 bereits für Spiehs unter Pseudonym den Schwank „Graf Dracula in Oberbayern“ gedreht hatte. 1981 schließlich wurde der Film unter dem Titel „Kalt wie Eis“ veröffentlicht und ist aus heutiger Sicht nicht nur eine exploitative Mischung aus Jugenddrama und Krimi, sondern ein faszinierendes Stück Berliner Zeit- und Lokalkolorit.
Schrauber Dave (Dave Balko) sitzt im Jugendknast für das Frisieren gestohlener Motorräder ein. Um wieder ungesiebte Berliner Luft zu schnuppern, nach seiner Freundin Corinna (Brigitte Wöllner) zu schauen und seinem ehemaligen Auftraggeber Kowalski (Otto Sander, „Das Boot“) die Möbel geradezuziehen, inszeniert er einen Selbstmordversuch und flieht beim Krankentransport, wobei sich ein Schuss löst, der einen Aufseher schwer verletzt. Hilfe bekommt Dave von einem Bekannten (Hanns Zischler, „Der Zementgarten“), der einen Musikclub betreibt. Nachdem er Corinna wiedergetroffen hat, kümmert er sich um Kowalski, schlägt ihn zusammen und knöpft ihm eine höhere Summe Geld ab. Daraufhin wird ein Schlägertrupp auf Dave gehetzt – und ebenfalls auf ihn abgesehen hat es Stripclub-Betreiber Hoffmann (Rolf Eden, „Ich – Ein Groupie“), für den Corinna seit einiger Zeit arbeitet und der etwas dagegen hat, dass Dave mit ihr durchbrennt. Die Luft der Mauerstadt wird für Dave immer dünner…
Von der Vorgeschichte weiß man zunächst nichts, denn Schenkels Film beginnt direkt im Jugendknast, in Daves karger Zelle. Schon die Flucht mit dem sich lösenden Schuss zeigt an, in welche Richtung es geht: Kein Sozialarbeiterfilm, hier wird scharf geschossen. Ein Konzertausschnitt einer Punkband leitet über zu Daves Beziehungskiste mit der fragilen, rehhaften Schönheit Corinna und anhand der Dialoge erfährt der Zuschauer etwas über die Hintergründe. Dass „Kalt wie Eis“ auch nicht mit Erotik geizt, wird deutlich, wenn Corinna mit Stöckelschuhen – und nichts außer ihnen – ins Bad geht, für Gleichberechtigung sorgt das Blankziehen Daves. Man erfährt noch, dass Corinna schwanger ist, bevor Dave seinen Rachefeldzug gegen Kowalski, der ihn in den Knast brachte, einleitet. Wut und Kompromisslosigkeit bestimmen diese Szenen; später wird Dave von Hoffmanns Schlägern übel zugerichtet und misshandelt Kowalskis Mob einen Freund Daves mit einem Rasiermesser. Blut fließt; Schenkel lässt keinen Zweifel daran, welch große Rolle Gewalt in seinem Film spielt.
Vor dem erschreckend konsequenten, fatalistischen Ende arbeiten Schenkel und Kameramann Horst Knechte immer wieder mit authentischen, teilweise ausgiebigen Konzertausschnitten der zeitgenössischen Berliner Punk- und New-Wave-Szene sowie mit künstlerischen Kniffen wie dramatischen Zeitlupen, kreativen Schnitten, Verfremdungen etc., an eine sehr freizügige Sexszene zwischen Corinna und Dave knüpft gar eine argentoeske Kamerafahrt. Atonale, enervierende Musik untermalt die eine oder andere Szene, Radio-Störgeräusche werden gezielt eingesetzt, um psychischen Stress zu unterstreichen. Daraus ergibt sich eine ebenso gewagte wie gelungene Mischung aus exploitativen Elementen und ebenso schöngeistiger wie effektiv eingesetzter Filmkunst sowie der Porträtierung der Subkultur im Kontext mit der Vermittlung eines authentisch anmutenden Berlin-Bilds.
Und eben dieses macht einen großen Teil des Reizes des Films aus. Es zeichnet die geteilte Stadt zwischen Nato und Warschauer Pakt als düsteren Ort mit beinharter Unterwelt und aufstrebender kreativer Szene, die die Eindrücke das Kalten Kriegs und der Post-Punk-Stimmung in ihren Liedern verarbeitet. Und während sich Bands wie „Tempo“ oder die „Neon Babies“ auf der Bühne ausdrücken, sitzen „Malaria“ bei Aufnahmen im Studio und Blixa Bargeld von den „Einstürzenden Neubauten“ wiederum als lebende Skulptur in einer Upper-Class-Kunstausstellung, den Skorbut-Song skandierend. Der Umgang der Menschen untereinander scheint kalt und verschlossen wie die Grenzmauern, emotionale Kälte und Armut bestimmt das wenig soziale Miteinander und macht das Lebensgefühl einer desillusionierten, perspektivlosen „No future“-Generation spürbar.
Hauptdarsteller Dave Balko war selbst Sänger bei „Tempo“, zusammen mit den genannten und weiteren Kollegen der Punk- und New-Wave-Bewegung sorgen sie für den großartigen und perfekt passenden Soundtrack zu Schenkels Berlin-Panorama. Auch als Schauspieler macht er eine gute Figur, möglicherweise seiner Unerfahrenheit geschuldete zeitweise Ausdruckslosigkeit scheint der Rolle wie auf den Leib geschneidert. Auch Brigitte Wöllner beweist viel Potential, so dass es schade ist, dass es bei diesem einzigen Einsatz als Schauspielerin für das ehemalige „Playboy-Playmate“ bleiben sollte. Ein Rolf Eden wiederum spielt sich anscheinend größtenteils schlicht selbst.
„Kalt wie Eis“ ist ein weitestgehend unterschätztes Kind seiner Zeit, das es versteht, den Zeitgeist nicht nur durch seine kalte Farbgebung zu visualisieren und akustisch zu untermalen, weshalb es als wichtiges Zeitdokument betrachtet werden sollte – das all seiner exploitativen Ausflüge, die aber eigentlich nur auf den ersten Blick dem Geist seiner Punk-Protagonisten widersprechen, und seines vermehrten Einsatzes betont langsamer, in ihrer Ausgewalztheit mitunter redundant erscheinenden Szenen (die wiederum die negative Atmosphäre begünstigen) sowie seiner Früh-’80er Künstlichkeit, die sich immer wieder Bahn bricht, zum Trotz gut gealtert ist und als Unterhaltungsfilm der etwas anderen Art und mit tiefschürfendem Subtext wunderbar funktioniert. 7,5 von 10 frisierten Krafträndern sind da locker drin, die mich hoffentlich nicht mit dem Gesetz in Konflikt bringen.